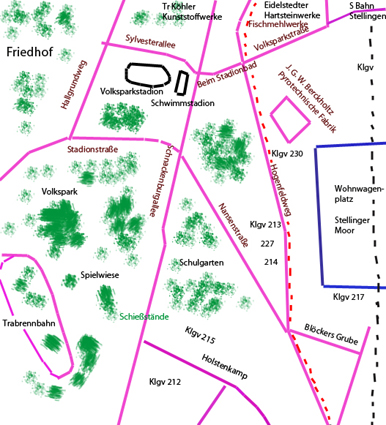|
Beim Betrachten der Fotos wird deutlich,
dass die hier dargestellten Menschen keineswegs traurig und verbittert
dreinschauten oder gar das Aussehen von verelendeten Menschen oder gar
von Gelegenheitsdieben hatten. Nein, die meisten waren ganz normale Durchschnittsmenschen,
die auch in jedem anderen Umfeld hätten leben können.
Armut galt am Ende der 50er Jahre noch nicht als besonders große
Schande, schließlich hatten viele mit Arbeitslosigkeit, niedrigen
Löhnen und fehlendem Wohnraum zu kämpfen. Da wir, ebenso wie
andere, versuchten, uns halbwegs sauber zu halten, hätten wir auch
aus einer Mietwohnung oder aus einem Einfamilienhaus kommen können.
Das Einkommen unseres Vaters war zwar sehr gering, aber dennoch achtete
er stets darauf, dass wir alle eine Musikschule besuchen konnten. In den
Zeitungen aber wurden wir, die Bewohner des Lagers, gern als asozial,
kriminell oder auch als „Zigeuner“ hingestellt:
|
| |
Artikel im Hamburger Abendblatt vom
06.01.1960 unter der Schlagzeile 'Prügel für die junge
Nina Krach im Zigeunerlager / ‚Heißer Krieg‘ in der Luft'
beschreibt eine junge Frau folgendermaßen: "Sie heißt
Nina, ist glutäugig und von blendender Architektur. Ganze 17 Lenze
alt." Ihr Ehemann, mit dem sie "nach Zigeunerart",
also "ohne Trauschein", verheiratet sei, so das Hamburger
Abendblatt, heiße Kola und sei "ein Mann mit lockigem Haar
und ungestümem Temperament. Wenn er sich erhitzt, und er tut es leicht,
dann knistert es." "Bizets unsterbliche Carmen lebt mitten unter
uns. Was sich gestern Abend im Zigeunerlager Rondenbarg in Stellingen
abspielte, passt genau zum Refrain aus der Habanera, in dem es so schön
heißt: ‚Die Liebe vom Zigeuner stammt, fragt nach Rechten nicht,
Gesetz und Macht."
Nina habe mit anderen Männern "techtelmechtelt",
Kola habe sie daher krankenhausreif geschlagen. "Danach flüchtete
er. Man möchte meinen, dass die Geschichte damit zu Ende sei. Mitnichten!
Es droht ein regelrechter Zigeunerkrieg auszubrechen, weil Ninas Brüder
beim Abtransport ihrer misshandelten Schwester ins Krankenhaus mithalfen.
Das verstößt gegen das Zigeunergesetz." Da die Familie
Ninas Racheakte von Familienmitgliedern Kolas befürchtet habe, so
ist dem Artikel zu entnehmen, riefen sie den "Peterwagen"
und ließen sich evakuieren. "Ihre Frauen und Kinder
sind jetzt im Lager Ostfalenweg untergebracht. Zigeunerkenner aber bezweifeln
den Wert dieser Maßnahme. Sie rechnen mit einem ‚Heißen
Krieg‘ zwischen den Familien Ninas und Kolas."
|
|
Die Schule am Hellgrundweg
Wie die meisten Kinder, so mussten auch
wir nach dem Schulunterricht die Hausaufgaben erledigen. Aus Platzgründen
konnte das aber nur am großen Küchentisch geschehen.
Im Sommer 1958 kam es an unserer Schule in der Nähe des Volksparkstadions
zu einer interessanten Veränderung: aus ihr wurde nämlich eine
„Versuchsschule“ gemacht, d.h. hier entstand die erste Ganztagsschule
der Freien und Hansestadt Hamburg, die 2008 ihr 50jähriges Jubiläum
feiern konnte.
Viele Eltern, aber auch einige Pädagogen, machten sich damals ernsthaft
Gedanken darüber, ob wir die zusätzliche Belastung eines ganztägigen
Schul-unterrichts überhaupt ertragen könnten und nicht überfordert
würden. (7)
Morgens um 8 Uhr begannen die Schulstunden und setzten sich bis 12 Uhr
fort. Danach folgte ein gemeinsames Mittagessen, das noch in den Klassenräumen
eingenommen werden musste, da es eine Mensa nicht gab. Nach einer Pause
von einer Stunde wurde schließlich der Unterricht um 13 Uhr wieder
aufgenommen und endete nachmittags um 16 Uhr. Und da prinzipiell keine
Schularbeiten aufgegeben wurden, konnten wir unsere Schultaschen getrost
unter unseren Schultischen zurücklassen und hatten den restlichen
Nachmittag zur freien Verfügung.
Man hatte damals bewusst die erste Ganztagsschule
der Stadt in diesem Teil Hamburgs eingerichtet, weil hier Nissenhütten-
und Wohnwagenlager nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren. Aus diesem
Grunde wussten auch die Lehrer, dass Leistungsschwächen einiger Kinder
nicht allein den Schülerinnen und Schülern angelastet werden
durften, sondern äußerliche Gründe dafür mitverantwortlich
waren. Diese Ursachen wollte man mit Hilfe des ganztägigen Unterrichts
zumindest minimieren helfen. Und in der Tat: während wir vorher nur
ungern zur Schule gegangen waren und uns hin und wieder freie Tage durch
einfaches Schwänzen verschafften, waren wir jetzt kaum noch zu halten,
dorthin zu kommen, vor allem dann, wenn der Speiseplan ein leckeres Mittagessen
versprach.
Viele Klassenkameraden und –kameradinnen
kamen aus dem Nissenhüttenlager an der Volksparkstraße, andere
von unserem Wohnwagenplatz im Stellinger Moor. Diejenigen hingegen, die
das Glück hatten, in einer Garten-laube mit Wasseranschluss leben
zu dürfen, betrachteten wir bereits als
„reich“.
Die Probleme heutiger Schülerinnen
und Schüler, immer nur die gerade angesagte Markenkleidung tragen
zu müssen, kannten wir zum Glück noch nicht. So war es keineswegs
selten, wenn ein Junge in Pantoffeln zur Schule gehen musste, weil das
einzige Paar Schuhe, das er besaß, gerade neu besohlt werden musste.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, in so einer Situation über
ihn zu lachen oder gar Witze darüber zu reißen, denn schließlich
konnte das jedem von uns passieren.
|
|
Wohnwagenalltag
Kaum eines der Kinder unserer Schule am
Altonaer Volkspark hatte zu Hause ein Badezimmer, ja die Wenigsten von
ihnen kannten einen Wasseranschluss in der Wohnung. Aus diesem Grunde
sah unser Stundenplan einmal in der Woche im Schulgebäude duschen
vor. Eine derart simple Maßnahme entlastete die Familien bereits
erheblich.
Am Badetag, das war in unserer Familie gewöhnlich der Freitag, musste
zunächst Wasser 150 Meter bis zum Wagen herangeschafft, dann in einem
großen Kessel erhitzt und schließlich in eine Badewanne geschüttet
werden. Nach dem Baden wurde das verschmutzte Wasser mit Eimern wieder
heraus geschöpft und schließlich zu einem 150 Meter entfernten
Abfluss gebracht.
Wenn jeder von uns Anspruch auf sauberes, unbenutztes Wasser gestellt
hätte, dann müsste dieser Vorgang bei 6 Personen auch 6mal wiederholt
werden. Stattdessen gingen wir Kinder nach und nach ins gleiche Wasser,
Brigitte, die bereits in einer Fabrik arbeitete, duschte sich dort täglich
und unsere Eltern badeten ebenfalls im gemeinsamen Wasser.
Einen elektrisch betriebenen Herd kannten
wir ebenso wenig, wie eine Waschmaschine, einen Kühlschrank oder
eine Zentralheizung. Wollte man es gemütlich warm haben, dann musste
der Ofen, der natürlich auch zum Kochen eingesetzt wurde, den ganzen
Tag über brennen. Das mochte an kalten Wintertagen ja noch ganz angenehm
gewesen sein; wenn es aber im Sommer 30 Grad heiß war, dann konnte
das Kochen am Herd zu einer ziemlichen Belastung werden.
Um Getränke auch an warmen Sommertagen relativ kühl zu halten,
legten wir sie in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Die Butter aber
wurde schnell ranzig, der Käse lief ebenso wie die Wurst an, und
Mett oder rohes Gulasch verbrauchte man tunlichst sofort, da es sonst
ungenießbar geworden wäre.
Die Große Wäsche einer sechsköpfigen Familie konnte nicht
nebenbei per Knopfdruck erledigt werden. Sie wurde noch in einem Kessel
auf dem Ofen gekocht, danach in eine Wanne gegeben und dort kam auch das
damals übliche Waschbrett zum Einsatz. Nach dem Waschen wurde alles
kräftig ausgewrungen und landete schließlich auf einer Leine.
Sobald sie trocken war, konnte unsere Mutter sich aber nicht genüsslich
zurücklegen und endlich durchatmen: jetzt musste sie die gesamte
Wäsche kontrollieren, eventuell vorhandene Risse flicken, Strümpfe
stopfen, Knöpfe annähen und Hemden bügeln. Schon aus diesem
Grunde war es kaum denkbar, Mütter, die unter derartigen Verhältnissen
lebten, mit einer Berufstätigkeit übermäßig zu belasten.
Die gesamte Fläche des Lagers war
mit Schotter befestigt. Da sich aber in diesem Material noch brennbare
Koksstücke befanden, suchten wir häufig die Wege ab und kamen
stets mit gefüllten Eimern zurück.
Äußerlich war der sandige Boden des Stellinger Moors zwar mager,
doch wuchsen dort schmackhafte Pilze in rauen Mengen, so z.B. der Birkenpilz
oder das Rotkäppchen, der Steinpilz oder auch der in Verruf geratene
Krempling, den wir damals noch in großen Mengen aßen, obwohl
er heute als giftig bezeichnet wird.
Auf dem Windsberg gab es zahlreiche Kleingartenkolonien,
die nach und nach aufgegeben werden mussten, da die Bagger den Berg unerbittlich
abtrugen.
Wir nutzten diese Situation aus, schafften in Kübeln und Eimern die
nicht mehr gebrauchte Muttererde von dort zu unserem Wagen herab, entnahmen
auch Büsche und Bäume und errichteten uns so einen eigenen kleinen,
gemütlichen Garten mit Stachel- und Johannisbeersträuchern,
mit Gurken, Tomaten- und Rhabarberpflanzen sowie mit bunten Blumenrabatten.
Und das Holz der achtlos zertrümmerten Lauben wanderte durch unsere
Öfen und sorgte so für eine angenehme Wärme.
Im Lager gab es zwei kleine Lebensmittelgeschäfte,
doch konnte man hier nur das Allernötigste erwerben. Gemeinsam mit
unserer Mutter begaben wir uns deshalb an jedem Sonnabend zu Fuß
zum Großeinkauf zu Kaisers Kaffee, einem frühen Supermarkt
am Schulterblatt. Dieser Weg, den wir dabei zweimal zurücklegen mussten,
hatte eine geschätzte Länge von jeweils 3 oder 4 Kilometern.
Und wenn der Kauf neuer Schuhe anstand, dann marschierten wir noch ein
gutes Stück weiter, zu „Schuh Goertz“, direkt am Neuen
Pferdemarkt.
In einem Lager wie dem im Stellinger Moor
kamen die unterschiedlichsten Qualifikationen und Berufe der Bewohner
zusammen. Viele von ihnen nutzten ihr Wissen und Können, um es an
die Mitbewohner gewinnbringend weiterzugeben. So gab es Friseure, die
ihre Kunstfertigkeit gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung stellten.
Ein Anderer verfügte über handwerkliche Fähigkeiten und
bekam jedes Schloss auf und jedes defekte Fahrrad wieder zum Laufen. Auch
er verstand es, seine Fähigkeiten nutzbringend für alle anzubieten.
Ein Dritter schließlich nutzte eine ehemalige Regentonne als Räucherofen
und garte über einem kleinen Buchenholzfeuer Makrelen, Aale, Heringe
und Forellen. Schon der Geruch, der an den Räuchertagen von seinem
Wohnwagen ausging, ließ bei uns das Wasser im Munde zusammenlaufen,
und wir konnten es gar nicht erwarten, diese Köstlichkeiten noch
warm zu probieren.
Das Zusammenleben mit Roma und Sinti bereitete
uns keine Schwierigkeiten, da wir einige Jahre zuvor gute Erfahrungen
mit dieser Bevölkerungsgruppe gemacht hatten. Gemeinsam mit ihnen
wurde gelegentlich musiziert oder mit deren Kindern herumgetobt. Unser
damaliges Schulsystem aber sortierte sie brutal aus und schickte die Jungen
und Mädchen auf Sonderschulen, so dass kaum eines von ihnen an unsere
Versuchsschule gesehen wurde.
|
|
Resümee
Das Leben am Rande des Existenzminimums
bedeutete für uns nicht, auf Feiern gänzlich zu verzichten oder
mit guten Freunden nicht zusammensitzen und gemeinsam essen zu können.
Natürlich feierten auch wir im tristen Stellinger Moor, aßen
und tranken gemeinsam, unterhielten uns ausgiebig, verstanden es noch,
selbst Musik zu machen und freuten uns des Lebens. Es reichte zwar nicht
für eine jährliche Urlaubsreise der Familie nach Italien, Spanien
oder nach Griechenland, aber man konnte ja auch mit der Straßen-
und der Eisenbahn bis in den Sachsenwald fahren und dort einen ganzen
Tag fröhlich verbringen. Für ein derartiges Vergnügen standen
wir früh auf, nahmen in Einmachgläsern für alle genügend
Kartoffelsalat ebenso mit, wie in Flaschen abgefülltes Trink-wasser.
Auch das genügte noch zum Glücklich sein.
Doch bei aller Nostalgie darf nicht vergessen
werden, dass man die heutige Bequemlichkeit keinesfalls mit den Strapazen
der damaligen Zeit tauschen möchte und sollte. Es ist einfach zu
verlockend, morgens nur die Heizung in der Wohnung aufzudrehen anstatt
erst umständlich einen Kohleofen anzuheizen, ins Bad zu gehen, wann
immer man es wünscht, sich zu duschen oder in die Wanne zu legen,
anstatt Wasser endlos lange zu schleppen. Die schmutzige Wäsche in
die Maschine zu packen ist angenehmer, als sie auf dem Waschbrett zu rubbeln,
und ein Kühlschrank ist ebenso wenig aus unserem Leben mehr wegzudenken,
wie ein Telefon, ein Computer, ein Auto oder eine Krankenversicherung,
die wir übrigens auch nicht hatten.
Und dennoch bin ich dankbar dafür,
eine Kindheit erlebt zu haben, die dem vorvergangenen Jahrhundert deutlich
näher stand als unserer heutigen Zeit.
Dieter Rednak
|
|
Anmerkungen
1 Vgl. hierzu: Dieter Rednak, „Sieben
zu ´ner Mark“. Das Leben des Postkartenhändlers Alois
Rednak.
In: Zitronenjette. Das Magazin für Hamburg. Hamburg 1997, Nr. 1,
S. 18 – 20
2 Vgl. hierzu: Anke Schulz: Hamburger
Zwangsarbeiterlager in der Lederstraße 1939 – 1945. Aachen
2010,
S. 43 ff sowie Rudko Kawczynski: Hamburg soll „zigeunerfrei“
werden. In: Angelika Ebbinghausen u.a., Heilen
und Vernichten im Mustergau Hamburg. Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik
im Dritten Reich. Hamburg 1984, S. 45 – 53
3 Vgl. hierzu: o. V.,: Hamburg in sechs
Monaten frei von Wohnwagenlagern.
Ab heute schon Zuzug verboten. In: Hamburger Abendblatt vom 22. 09.1959
4 o.V., Wohnwagen müssen ins Stellinger
Moor. Mitte und Altona räumen
bereits die Lagerplätze. In: Hamburger Abendblatt vom 25.09.1957
5 Vgl.: oV., Ortsausschuss warnt vor Slums.
In: Hamburger Abendblatt vom 12.06.1958
6 Vgl.: o. V., Gegen Wohnwagenübel.
In: Hamburger Abendblatt vom
16.05.1959, sowie: Vorrang für Neues Gesetz/ 145 Zigeuner kamen aus
Polen.
Wohnen im Wohnwagen ist grundsätzlich verboten. 27.2.1959
7 Vgl.: o.V., Die Fünf-Tage-Schule
hat Exportchancen. Pädagogen von den Hamburger Versuchen beeindruckt.
In: Hamburger Abendblatt vom 05.12.1960
|
 Klaus und Dieter 1952 bei der Kartoffelernte © Foto Dieter Rednak
Klaus und Dieter 1952 bei der Kartoffelernte © Foto Dieter Rednak